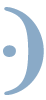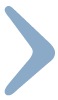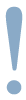Das benommene Jahr
Von René Müller-Ferchland
In meinem ersten veröffentlichten Roman gibt es den „Salon Corona“, ein abgefahrenes Event, bei dem eine Künstlerkolonie exzentrische Kostümfeste feiert – und dies in einem kranzförmigen Hof, umgeben von bröckelndem Gemäuer. Aber nicht nur wegen der Form des Hofes erhielt dieses Spektakel den Namen, mir gefiel einfach dieses Wort „Corona“, das von sich aus schon irgendwie zu leuchten schien. Fast hätte ich den ganzen Roman so genannt.
Zu Beginn des Jahres 2020 noch konnte ich aus meinem Buch lesen, unter anderem in einer dicht besetzten Kneipe bei schummrigem, etwas staubigem Schreibtischlicht. Eng an eng sah ich meine Zuhörer zusammensitzen und machte mir – wohl ebenso wie sie – keinerlei Gedanken über Berührungen, Körperabstände, über meinen oder ihren Atem, sondern konnte mit ihnen ganz in meine Geschichte eintauchen, in diesen geheimnisvollen Salon. Da war so viel, nur keine Angst, denn das, was da irgendwo am Horizont aufzog, war noch viel zu abstrakt. Nach der Lesung schüttelte ich einige Hände. Schön war das, denke ich heute.
Dann fiel meine erste Lesung auf der Leipziger Buchmesse aus. Das war schade, aber verkraftbar. Auf dem Weg zum Brotjob begegneten mir peu à peu weniger Menschen, bis das Stadt- und Straßenleben in Erfurt sogar ganz erlosch. In den Fenstern der Kinderzimmer erschienen Regenbogenbilder und ich begann mich zu fragen, was das mit ihnen macht. Was macht das mit einem Kind, wenn es nicht mehr unbedacht seinen Freunden nahekommen darf, wenn es permanent darauf achten muss, sich die Hände zu waschen? Wenn es nicht zur Schule gehen darf?
Mit der Zeit machte es aber selbst mit mir als Schriftsteller etwas, mit mir, dessen Blick zumal sehr solipsistisch geprägt ist, um die Geschichte, die ihn gerade beschäftigt, empfangen und verarbeiten zu können und dem das Sich-von-der-Gemeinschaft-Abtrennen mitunter durchaus entgegenkommt. Ab einem bestimmten Punkt war es nämlich keine selbstgewählte Isolation mehr, sondern eine – wenn auch aus den besten Gründen – von außen aufoktroyierte. Ich erinnerte mich an so manches Unwetter, das ich in meiner Stadt Erfurt schon erlebt habe, die Orkane Kyrill und Friederike legten damals in kürzester Zeit das gesellschaftliche Leben lahm. Das Corona-Virus und die Angst vor ihm kamen nun zwar – zumindest aus meiner Sicht – eher schleichend, die größere Wucht entfaltete sich aber schon bald und blieb viel länger als diese verheerenden Wirbelstürme. Jeder einzelne Bürger wurde davon gleichermaßen, aber eben länger erfasst und ergriffen und in gewisser Weise angehalten. Ein guter Freund durfte erst kurz vorher zur Geburt seines Kindes hinzukommen, da lag seine Freundin bereits seit einem ganzen Tag in den Wehen. Meinem Bruder war es lediglich für eine Stunde am Tag gestattet, seine Verlobte und die neugeborene Tochter zu besuchen. Meiner Großmutter konnten wir zum 99. Geburtstag nicht mit Umarmungen gratulieren, das Geburtstagsständchen nur aus sicherer Entfernung singen. Vorsichtsmaßnahmen wie diese wirken nach, machen 2020 zu einem benommenem, wie nur bruchstückhaft erlebten Jahr.
Und dann war es leider so weit, da war nicht mehr nur die Angst vor dem Virus – das Virus selbst kam plötzlich ganz nah – , im nächsten Umfeld erkrankte jemand schwer. Damit kam nicht nur die Sorge um diesen Menschen, sondern auch die Notwendigkeit, sich selbst testen zu lassen. Die Stunden des Wartens auf das Ergebnis bekam ich nur mit Mühe herum, an so etwas wie Schreiben und also Hervorbringend-tätig-Sein war an diesem Tag nicht zu denken, das Warten benahm mir ganz die Sicht auf das, was eigentlich immer in mir ruht: die Geschichte, an der ich arbeite, die Welt, in der ich im Grunde auch lebe.
Dennoch bin ich – der sicherlich aus einer privilegierten Perspektive spricht, weil er keine wirtschaftlichen oder größeren sozialen Einbußen verzeichnen musste – nicht versucht, dieses Jahr als ein verlorenes oder gestohlenes zu bezeichnen, denn ich persönlich habe nichts verlieren müssen. Viel zu sehr bin ich auch noch damit beschäftigt zu verstehen, was da um uns herum geschehen ist und noch geschieht, zu fassen, was am Ende dann aber doch zu klein ist, um fassbar zu sein, was aber die ganze Welt ergriffen hat mit allen Konsequenzen, die ich mir bislang nicht hätte vorstellen können oder wollen, die Dystopie ist so gar nicht mein Genre. Mir soll es jetzt darum gehen, aus dieser Benommenheit aufzuwachen und mich auf meine neue Hauptfigur zu konzentrieren, die dieses Jahr zu mir gekommen ist – eine nicht nur von der Gesellschaft entrückte Person, die von sich aus eine solche Menschenansammlung, wie ich sie in meinem „Salon Corona“ beschrieben habe, eher meiden würde.

René Müller-Ferchland wurde 1984 geboren und studierte Literaturwissenschaft und Philosophie in Erfurt. Er hat für Kultur-, Wirtschafts- und Jugendmagazine gearbeitet und ist seit 2015 freier Schriftsteller.
Zum Eintrag in der Autoren-Datenbank hier ».